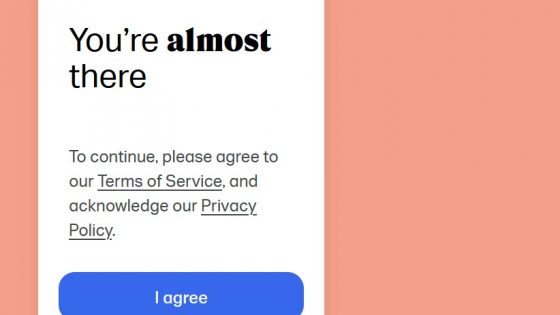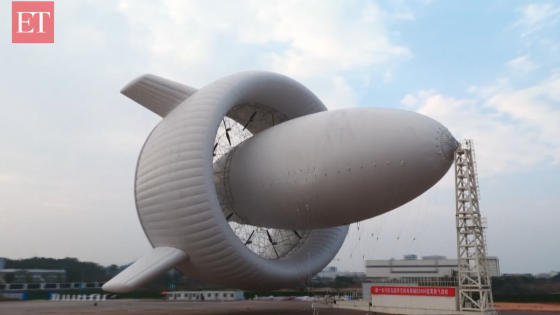Deregulierung der Digitalregulierung in der Europäischen Union?

Zu den wichtigsten Gesetzen zählen der Digital Services Act (DSA), der Digital Markets Act (DMA), der Data Governance Act (DGA), der Data Act (DA) und der Artificial Intelligence Act. Es handelt sich um eine umfassende Reform der digitalen Rechtsordnung, deren Hauptziel der Schutz der Grundrechte, die Nutzersicherheit, die Marktgerechtigkeit und die technologische Souveränität der EU war.
Dieser Regulierungsschub stößt jedoch auf zunehmende Kritik seitens der Industrie, einiger Mitgliedstaaten und sogar der europäischen Institutionen. Sie weisen darauf hin, dass die Folgen Überregulierung, rechtliche Komplexität, Verwaltungsaufwand und in der Folge eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit europäischer Digitalunternehmen seien. Als Reaktion darauf entstand die Idee einer „Omnibus“-Deregulierungsinitiative, die in der nächsten Legislaturperiode einige digitale Regulierungspflichten vereinfachen, straffen oder sogar abschaffen soll.

Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die auch das Rückgrat der slowenischen Wirtschaft bilden, berichten von einer „Regulierungslähmung“, da sie nicht mehr in der Lage sind, mit der Vielzahl der regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten. In vielen Fällen führt Regulierung zum gegenteiligen Effekt, da Unternehmen es vorziehen, bestimmte Aktivitäten aufzugeben, anstatt das Risiko einer Nichteinhaltung von Vorschriften einzugehen. Das europäische Modell wird der Realität gerecht: Die USA bauen ihre digitale Wettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage sektoraler Selbstregulierung auf, während China sie auf einer Zentralisierung der Aufsicht aufbaut. In diesem Zusammenhang lautet die Schlüsselfrage, ob die EU in der Lage sein wird, alle Regulierungsziele zu verfolgen und gleichzeitig Innovation und Wachstum zu fördern. Als kleines Land mit begrenzter Regulierungskapazität war Slowenien eines der ersten, das Initiativen zur Vereinfachung der digitalen Regulierung unterstützte. Die für die Umsetzung der Regulierung der digitalen Wirtschaft zuständigen nationalen Behörden warnen seit langem vor Personalmangel, rechtlicher Fragmentierung und Compliance-Problemen der KMU. Daher wird es für Slowenien von entscheidender Bedeutung sein, aktiv an der Gestaltung des Inhalts des „Omnibus“-Pakets mitzuwirken.
Omnibus
Der Begriff „Omnibus“ bezeichnet im Gesetzgebungskontext üblicherweise ein horizontales Gesetzgebungsinstrument, das mehrere bestehende Vorschriften in einem Rechtsakt ändert, um sie zu vereinheitlichen, zu vereinfachen oder zu straffen. Im Kontext der digitalen Deregulierung der EU handelt es sich dabei um eine Initiative, die überlappende Anforderungen zwischen DSA, DMA, KI-Gesetz, Datengesetz usw. beseitigt, Definitionen standardisiert, Konformitätsverfahren vereinfacht und die regulatorische Fragmentierung zwischen den Mitgliedstaaten verringert. Obwohl noch kein formeller Vorschlag der Europäischen Kommission vorliegt, haben in Kreisen innerhalb der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien (DG CNECT) und des Generalsekretariats des Rates bereits vorbereitende Diskussionen über die Möglichkeit eines gemeinsamen Deregulierungspakets in den Jahren 2026 oder 2027 begonnen. Als mögliche Lösung wird der Vorschlag genannt, eine einzige „Erklärung zur digitalen Konformität“ für mehrere Regulierungsbehörden gleichzeitig zu erstellen. Das Deregulierungspaket könnte eine einzige Anlaufstelle, gemeinsame Meldeportale und zentralisierte Register einführen.
Besonderes Augenmerk sollte auf die Abschaffung oder Vereinfachung bestimmter Anforderungen für Kleinst- und Kleinunternehmen gelegt werden, wie etwa Ausnahmen von der Pflicht zur Folgenabschätzung im Hinblick auf die Grundrechte, eine seltenere Berichterstattung und automatisierte Tools zur Selbstbewertung der Einhaltung der Vorschriften.
Es gibt jedoch auch (berechtigte) Bedenken: Zivilgesellschaftliche Organisationen und Wissenschaftler befürchten vor allem, dass die Deregulierung hart erkämpfte Standards beim Datenschutz, der Online-Sicherheit von Kindern und anderen Grundrechten digitaler Dienste untergraben könnte. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass einzelne EU-Mitgliedstaaten der Deregulierung nicht zustimmen, da einige bereits nationale, überdurchschnittliche Praktiken eingeführt haben.
Probleme bei der Umsetzung des Künstliche-Intelligenz-Gesetzes
Das Künstliche Intelligenz-Gesetz (KI-Gesetz), das im Frühjahr 2024 von der Europäischen Union formell verabschiedet wurde, ist der weltweit erste umfassende Rechtsrahmen zur Regulierung künstlicher Intelligenz (KI). Ziel des Gesetzes ist es, eine sichere Nutzung von KI unter Wahrung der Grundrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit zu ermöglichen und gleichzeitig Innovation und technologische Entwicklung in der EU zu fördern.

Das Gesetz basiert auf einem risikobasierten Ansatz und klassifiziert KI-Systeme nach ihren potenziellen Auswirkungen auf Einzelpersonen und die Gesellschaft. Systeme mit inakzeptablem Risiko sind verboten, Systeme mit hohem Risiko unterliegen strengen Vorschriften, während Systeme mit begrenztem oder minimalem Risiko der freiwilligen Selbstregulierung überlassen bleiben.
Die Umsetzung des KI-Gesetzes steht jedoch vor ernsthaften Herausforderungen hinsichtlich Rechtsklarheit, technischer Machbarkeit, institutioneller Kapazitäten und der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, einschließlich Sloweniens. Trotz politischer Unterstützung auf EU-Ebene bleiben einige Fragen offen, die die Wirksamkeit und Pünktlichkeit der Umsetzung beeinträchtigen können. Eines der zentralen Probleme des KI-Gesetzes ist die rechtliche Unklarheit und Komplexität bei der Einstufung von KI-Systemen in einzelne Risikokategorien. In der Praxis ist oft unklar, wann eine KI-Anwendung ein „hohes Risiko“ darstellt – insbesondere bei der Kombination mehrerer Funktionalitäten. Nutzer und Entwickler müssen Selbstbewertungen durchführen, was insbesondere für mittelständische und kleine Unternehmen einen erheblichen regulatorischen Aufwand darstellt. In Slowenien gibt es aufgrund der Fragmentierung der Sektoren und des Fehlens einer zentralen Regulierungsbehörde bereits heute Schwierigkeiten, die Anforderungen an die Risikobewertung von KI-Systemen zu verstehen. Das KI-Gesetz sieht zudem die Einführung sogenannter „Regulatory Sandboxes“ vor – kontrollierter Umgebungen zum Testen von KI-Lösungen. In Slowenien wurde bisher noch kein „Regulatory Sandbox“ eingerichtet, was die Beteiligung von Innovatoren an der Weiterentwicklung KI-basierter Lösungen behindert. Gleichzeitig hat Slowenien bis zum Sommer 2025 noch keine zuständige Behörde benannt und in der Praxis gibt es keine klare Abgrenzung zwischen Institutionen wie dem Informationsbeauftragten, dem Ministerium für digitale Transformation, dem Amt für Informationssicherheit usw.
Abschluss
Im Vergleich zu den USA, die auf sanfte Selbstregulierung setzen, und China, das strenge Kontrollen einführt, hat die EU den Weg einer formalen Regulierung der KI-Einführung auf allen Ebenen eingeschlagen. Die USA nutzen freiwillige Prinzipien (z. B. das NIST AI Framework), während China strenge Vorregistrierungs- und Sicherheitsbewertungen anwendet. Die EU ist die einzige EU, die einen sehr komplexen und rechtsverbindlichen Rahmen geschaffen hat, was zunehmend die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Marktes aufwirft. Der Artificial Intelligence Act ist zweifellos ein historischer Schritt in der rechtlichen Regulierung von KI. Sein Erfolg wird von der technischen Umsetzung der Bestimmungen, einer klaren institutionellen Aufgabenteilung, der rechtzeitigen Einrichtung von Unterstützungsmechanismen und der Anpassung an die sich rasch entwickelnde Technologie abhängen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die europäische Regulierung Innovationen eher behindert als fördert. Die Deregulierung des digitalen Sektors in der EU ist daher kein Aufruf zur Abschaffung der Rechtsordnung, sondern ein Bemühen um eine wirksamere, koordiniertere und verhältnismäßigere Regulierung. Die Deregulierungsinitiative „Omnibus“ bietet der EU die Möglichkeit, eine Regulierungssättigung zu vermeiden, und Slowenien als aktives Mitglied bietet sich die Möglichkeit, zur Schaffung eines rationalen europäischen digitalen Rahmens beizutragen.